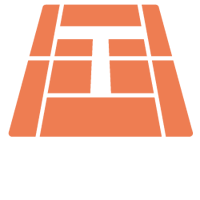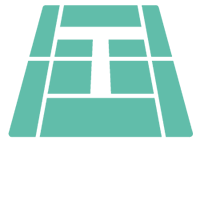Mit dem fortschreitenden Klimawandel stehen Tennisvereine vor zunehmend komplexen Herausforderungen. Längere Trockenperioden und häufiger werdende Extremwetterereignisse stellen erhebliche Anforderungen an die Pflege und Instandhaltung von Tennisplätzen. Der Trend hin zu ganzjährig nutzbaren Anlagen und der Wunsch nach ressourcenschonenden Lösungen erfordert ein Umdenken in der Planung und Umsetzung von Platzsanierungen und Neubauten.
Julia Höhn ist Leiterin der Vereinsberatung und Sportentwicklung beim Bayerischen Tennisverband (BTV) und beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit dem Tennisplatz der Zukunft. Sie initiiert Kooperationen mit Herstellern, organisiert Beratungsangebote für Vereine und testet innovative Beläge und Technologien. In diesem Interview teilt Julia Höhn ihre Erfahrungen und Einblicke zu den aktuellen Herausforderungen für Tennisvereine. Sie gibt wertvolle Tipps, wie diese Herausforderungen gemeistert werden können, und erläutert, welche modernen Ansätze und Lösungen für die Zukunft der Tennisplätze relevant sind.
Für wie dringend halten Sie es, dass sich Tennisvereine mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen klimatischen Herausforderungen zeitnah mit dem Thema Platzsanierung beschäftigen?
Viele Tennisvereine stehen aktuell oder in naher Zukunft vor der Notwendigkeit, ihre bestehenden Plätze grundlegend zu sanieren. Eine Sanierung oder ein Neubau wird in der Regel dann in Erwägung gezogen, wenn die Plätze deutliche Abnutzungsspuren zeigen oder die Platzpflege durch klimatische Veränderungen erheblich erschwert wird – etwa bei Wassermangel, der die Bewässerung von Sandplätzen zunehmend problematisch macht.
Sanierungen und Neubauten erfordern allerdings eine gründliche und sorgfältige Planung, die oft längere Vorlaufzeiten in Anspruch nimmt. Deshalb ist es ratsam, dass sich Vereine frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen, um genügend Zeit für die Planung, Finanzierung und Umsetzung zu haben. Eine durchdachte Investition in die Sanierung kann nicht nur langfristig Kosten sparen, sondern auch die Attraktivität des Vereins steigern. Wichtig ist jedoch, kein überstürztes Handeln an den Tag zu legen. Vereine sollten vorab verschiedene Beläge testen, Referenzen einholen und sich mit anderen Vereinen austauschen, um die bestmögliche Lösung zu finden.
Wie setzt sich der Bayerische Tennisverband mit dem Thema Platzbelag auseinander? Gibt es spezielle Initiativen oder Projekte?
Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit intensiv mit unterschiedlichen Platzarten und -belägen und testen sie, um ihre Eigenschaften und Spielqualitäten zu prüfen. Außerdem bieten wir regelmäßig Webinare und Workshops an, wie zum Beispiel unseren Infrastrukturworkshop, bei dem alle relevanten Partner zusammenkommen. Diese Veranstaltungen sind eine wichtige Plattform für Vereine, um sich über neue Entwicklungen im Platzbau zu informieren und individuell beraten zu lassen – auch zu Themen wie Fördermöglichkeiten.
Darüber hinaus tauschen wir uns kontinuierlich mit anderen Landesverbänden und dem DTB aus, um bewährte Erfolgsmodelle zu teilen und voneinander zu lernen. So stellen wir sicher, dass unsere Vereine bestmöglich informiert sind und fundierte Entscheidungen treffen können.
Welche ersten Schritte sollten Vereine unternehmen, wenn sie eine Platzsanierung oder einen Neubau planen? Welche Tipps gebt ihr den Vereinen, um den Prozess effektiv zu gestalten?
Zunächst raten wir Vereinen, eine gründliche Bestandsaufnahme des aktuellen Zustands ihrer Plätze durchzuführen. Auf dieser Basis sollten sie sich einen Überblick über die verschiedenen Platzbeläge verschaffen und prüfen, welche Anforderungen die jeweiligen Beläge erfüllen können. Es ist wichtig, klar zu definieren, welche Prioritäten der Verein hat: Soll der Platz ganzjährig genutzt werden können, steht die Wassereinsparung im Vordergrund oder geht es darum, den Pflegeaufwand zu minimieren? Auch die Frage, ob ein sandplatzähnlicher Belag gewünscht ist oder ein Hardcourt in Frage kommt, sollte frühzeitig geklärt werden.
Wir empfehlen den Vereinen dringend, sich professionell beraten zu lassen, um die für ihre individuellen Bedürfnisse passende Lösung zu finden. Ein detaillierter Sanierungsplan, der sowohl technische als auch finanzielle Aspekte berücksichtigt, ist unerlässlich. Dabei sollten auch Nachhaltigkeitsaspekte einfließen, um die langfristige Nutzung und Pflege der Plätze zu erleichtern.
Es ist außerdem wichtig, die Mitglieder und Engagierten des Vereins frühzeitig in den Planungsprozess einzubinden, um Akzeptanz und Unterstützung zu sichern. Die Finanzierung sollte ebenfalls von Beginn an im Blick behalten werden, inklusive der Prüfung von Fördermitteln, die zur Verfügung stehen könnten.
Viele Vereine glauben, dass sie sich eine Platzsanierung oder einen Neubau finanziell nicht leisten können. Welche Finanzierungsmöglichkeiten und Optionen stehen den Vereinen zur Verfügung, um diese Hürden zu überwinden?
Es gibt verschiedene Wege, wie Vereine die Finanzierung einer Platzsanierung oder eines Neubaus stemmen können. Eine zentrale Möglichkeit bietet die Sportförderung der meisten Bundesländer. In Bayern beispielsweise werden je nach Standort zwischen 20-55 % der Kosten durch öffentliche Fördermittel abgedeckt. Auch die örtlichen Gemeinden gewähren häufig zusätzliche Zuschüsse.
Darüber hinaus bieten sich Sponsoring und Partnerschaften mit lokalen Unternehmen als Finanzierungslösungen an. Ein Verein in Bayern hat erfolgreich sogenannte "Platzbausteine" an lokale Unternehmen und Mitglieder verkauft, die symbolisch als Sponsoren des neuen Platzes auftraten.
Auch Crowdfunding oder Mitgliederdarlehen können weitere Wege zur Finanzierung darstellen. Durch Spendenaktionen oder spezielle Mitgliedsaktionen lassen sich die Vereinsmitglieder aktiv in die Finanzierung einbinden.
Langfristig gesehen können durch eine Platzmodernisierung die Pflegekosten gesenkt und neue Mitglieder gewonnen werden, was die finanzielle Lage des Vereins stabilisiert. Zudem relativieren sich die anfänglichen Kosten durch die lange Haltbarkeit vieler Platzbeläge.
Viele Banken bieten ebenfalls spezielle Darlehen für Sportvereine an, oft zu günstigen Konditionen. Ein detailliertes Finanzierungskonzept und die Aussicht auf höhere Einnahmen können die Chancen auf eine positive Kreditzusage erheblich erhöhen.
Welche neuen Technologien oder innovativen Platzbeläge gibt es, die den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen besser gewachsen sind?
Aktuell gibt es verschiedene innovative Platzbeläge, die speziell auf die klimatischen und pflegetechnischen Anforderungen von Tennisvereinen zugeschnitten sind. Eine wichtige Entwicklung sind Beläge, die deutlich weniger oder gar kein Wasser benötigen, aber dennoch ein hochwertiges Spielverhalten ermöglichen. Hybridbeläge kombinieren die Vorteile verschiedener Materialien. Diese Beläge sind besonders langlebig, pflegeleicht und bieten eine flexible Nutzung bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Sie stellen daher eine zukunftssichere Lösung dar, um den Herausforderungen besser gerecht zu werden.
Traditionell müssen alle Plätze mit Ziegelmehl als Oberbelag bewässert werden, auch wenn sie auf Untergründen wie Kunstrasen, Teppich oder einer gehärteten Gummigranulatmischung basieren. Alternativen wie Keramiksand oder Acrylbeläge als Oberschicht kommen ohne Bewässerung aus und bieten dennoch eine gute Bespielbarkeit.
Bei Neubauten oder Erweiterungen sollten Allwetterplätze ernsthaft in Betracht gezogen werden, da sie aufgrund ihrer ganzjährigen Bespielbarkeit eine immer attraktivere Option darstellen.
Gibt es Beispielvereine und -projekte, die bereits erfolgreich moderne und nachhaltige Lösungen für ihre Tennisplätze umgesetzt haben?
Einige Tennisvereine haben bereits erfolgreich innovative und nachhaltige Lösungen für ihre Plätze umgesetzt. So hat der TA SV Holzgerlingen eine Zisternenanlage installiert, die das Regenwasser auffängt und speichert. Die Entwässerung der vereinseigenen Drei-Feld-Halle erfolgt über neue Grundleitungen, die in diese Zisternenanlage führen. Die Bewässerung der Plätze wird über eine Unterwasserpumpe (UW-Pumpe) realisiert, wobei Frischwasser nur bei Bedarf nachgespeist wird. Diese Maßnahmen haben nicht nur die Wasserverbrauchskosten erheblich gesenkt, sondern auch die gesplittete Abwassergebühr reduziert.
Auch der TC Grün-Weiss Luitpoldpark München hat durch die Installation einer modernen Beregnungsanlage mit fortschrittlicher Pumpentechnik nachhaltige Schritte unternommen. Eine Rohrnetz-Trennung wird durch einen unterirdisch installierten Flachtank ermöglicht, der den freien Frischwasser-Zulauf regelt und durch eine Unterwasserpumpe ergänzt wird. Diese Maßnahmen haben die Effizienz der Bewässerung gesteigert und helfen dabei, den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Ein weiteres interessantes Beispiel ist der TC Greding, der seinen Mitgliedern nun eine größere Vielfalt an Platzbelägen bietet. Neben den sechs traditionellen Ziegelmehlplätzen hat der Verein zwei Allwetterplätze installiert. Einer dieser Plätze besitzt eine Ziegelmehloberfläche, die es ermöglicht, ihn auch im Wettspielbetrieb mit den herkömmlichen Plätzen zu kombinieren. Der zweite Allwetterplatz ist mit einem Acrylbelag ausgestattet, der den Spielern eine alternative Spielvariante bietet, die sehr gut angenommen wird. Darüber hinaus hat der Verein Flutlichtanlagen installiert, was besonders in Kombination mit den Allwetterplätzen vorteilhaft ist, da dadurch die Spielzeiten im Frühjahr und Herbst deutlich verlängert werden können.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Tennisplätze in den nächsten 10 Jahren? Welche Trends und Veränderungen erwarten Sie? Was können Vereine tun, um sich bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten?
Die kommenden Jahre werden eine Reihe von Entwicklungen für Tennisplätze mit sich bringen. Ein klarer Trend zeichnet sich bereits ab: Die Nachfrage nach multifunktionalen Anlagen, die ganzjährig genutzt werden können, wird zunehmen. Hierbei werden Überdachungen und Allwetterbeläge zunehmend an Bedeutung gewinnen, um den Spielbetrieb bei verschiedenen Wetterbedingungen aufrechterhalten zu können.
Ein weiterer wesentlicher Trend ist die Steigerung der Effizienz in der Platzpflege. Die Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs wird immer wichtiger. Automatisierte Bewässerungssysteme und energieeffiziente Beleuchtung werden verstärkt zum Einsatz kommen, um Ressourcen zu schonen und Betriebskosten zu senken. Zusätzlich könnten Sensoren zur Überwachung von Platzbedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur eine präzisere und ressourcenschonendere Pflege ermöglichen.
Die Vielfalt der Platzbeläge wird sich weiterentwickeln. Es ist kaum vorstellbar, dass traditionelle Ziegelmehlplätze in zehn Jahren noch die einzige Wahl bleiben werden. Stattdessen wird es eine größere Bandbreite an Platzbelägen geben, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Spieler:innen abgestimmt sind. Vereine könnten davon profitieren, wenn sie verschiedene Beläge anbieten, um unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden.
Auch die Überdachung und Beschattung der Plätze wird eine zunehmend größere Rolle spielen. Insbesondere in heißen Sommermonaten könnte eine Überdachung für eine angenehmere Spielumgebung sorgen und Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung bieten, was vor allem für Kinder und Senioren von Vorteil ist.
Um sich auf diese Entwicklungen optimal vorzubereiten, sollten Vereine den Austausch mit anderen Vereinen und Verbänden suchen. Der Dialog und das Teilen von Erfahrungen können wertvolle Einblicke und Ideen liefern. Zudem ist es ratsam, die Beratungsangebote und Informationsmaterialien der Landesverbände, Landessportbünde und des DTB zu nutzen. Diese Ressourcen bieten Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Platzsanierungen und Neubauten und helfen dabei, aktuelle Trends aufzugreifen und innovative Lösungen zu integrieren.